Viele Kliniken können Patienten, die aus medizinischer Sicht keine stationäre Behandlung mehr benötigen, nicht zeitnah entlassen. Häufige Gründe sind bestehende, vor allem pflegerische Bedarfe oder die sogenannte „soziale Indikation“. Damit fehlen Versorgungskapazitäten für Patienten, die dringend akut behandlungsbedürftig sind. Zudem führen die regelmäßigen Fallprüfungen bei Patienten, die oberhalb der Grenzverweildauer im Krankenhaus verbleiben, zu großem bürokratischen Aufwand.
Wie groß sind die Probleme an den Kliniken? Und welche Lösungsoptionen gibt es? Darüber diskutierten die Teilnehmer des Luncheon Roundtable der Rhön Stiftung im Juni.
Zu den Teilnehmern gehörten:
- Dr. med. Christine Adolph, Vorständin MD Bayern
- Dr. med. Bettina Beinhauer, Leiterin Medizinmanagement, AGAPLESION gAG
- Dr. Achim Jockwig, Vorstandsvorsitzender Klinikum Nürnberg
- Sophie Schwab, Leiterin der Landesvertretung Bayern, DAK Gesundheit
- Martin Spegel, Bereichsleiter SBK
- Stefan Wöhrmann, Leiter Abteilung Stationäre Versorgung vdek
sowie von der Stiftung Münch Professor Boris Augurzky, Eugen Münch, Professor Bernd Griewing, Professor Andreas Beivers und Annette Kennel.
In immer mehr Fällen können Patienten, die in den Notaufnahmen ankommen und eine stationäre Versorgung benötigen, nicht aufgenommen werden, denn: Viele Betten der Kliniken stehen nicht zur Verfügung – es fehlt das nötige Personal. Umso wichtiger ist es, dass die Patienten, bei denen keine akutstationäre Behandlung im Krankenhaus mehr erforderlich ist, entlassen bzw. in andere, niedrigschwellige Versorgungseinheiten verlegt werden. Doch dies ist oft nicht möglich.
Bei einem Teil dieser Patienten handelt es sich um mittel bis komplexe pflegerische Fälle, die insbesondere in eine Kurz- oder Langzeitpflegeeinrichtung oder in eine Rehabilitationseinrichtung verlegt werden müssten. Ein anderer Teil sind schwer erkrankte Patienten, die eine Versorgung zum Beispiel in einem Hospiz oder einen Beatmungsplatz benötigen.

Fehlende Möglichkeiten für ambulante Betreuung: Aufgabe der Kliniken?
Ein weiterer Teil der Patienten könnte stationsersetzend behandelt und somit nach Hause entlassen werden. Doch oft bestehen Ängste und Unsicherheiten, sodass auch diese Patienten weiter in der Klinik versorgt werden. „Es fehlt an Möglichkeiten für ambulante Physiotherapie, Pflege, Hauswirtschaft oder eine Kombination aus allem“, so ein Teilnehmer der Diskussionsrunde. Er monierte, dass die Aufgabe, dies zu organisieren, nicht die originäre Aufgabe eines Klinikums sei: „Wir sind die teuerste Versorgungseinheit und es ist auch nicht die Kompetenz des komplexen Schiffes Medizinbetrieb, die nachgelagerten sozialen Lösungen zu organisieren.“ Ein anderer Teilnehmer fügte hinzu, dass das ambulante Entlassmanagement in der Regel nicht funktionieren würde. Ausnahme seien elektive Patienten, bei denen die Weiterbehandlung im Vorfeld organisiert werden kann.
Dem widersprachen andere Diskussionsteilnehmer. Würde eine Klinik ihre gesellschaftlichen und regionalpolitischen Aufnahmen bewusst wahrnehmen, könne die Abverlegung gut funktionieren. Dazu muss die Klinik aktiv werden und alle in der Region beteiligten Institutionen und Personen einbinden. Das sei nicht leicht, kann aber gelingen. „Die Möglichkeiten, das zu tun, haben wir“, betonte ein Diskutant. Er berichtete davon, dass an einem Klinikstandort, wo dies gut gelungen sei, auch der wirtschaftliche Erfolg der Klinik am größten sei. Deshalb appelliere er an alle, aus Krankenhaus heraus die Netzwerke selbst aktiv aufzubauen und zu betreiben. Allerdings sei dies zum einen stark abhängig davon, ob sich die Klinik in einer ländlichen Region oder in einer Stadt befindet. Zum anderen gelänge es auch einfacher, wenn dort nur eine größere Klinik als „Monopolist“ ist.
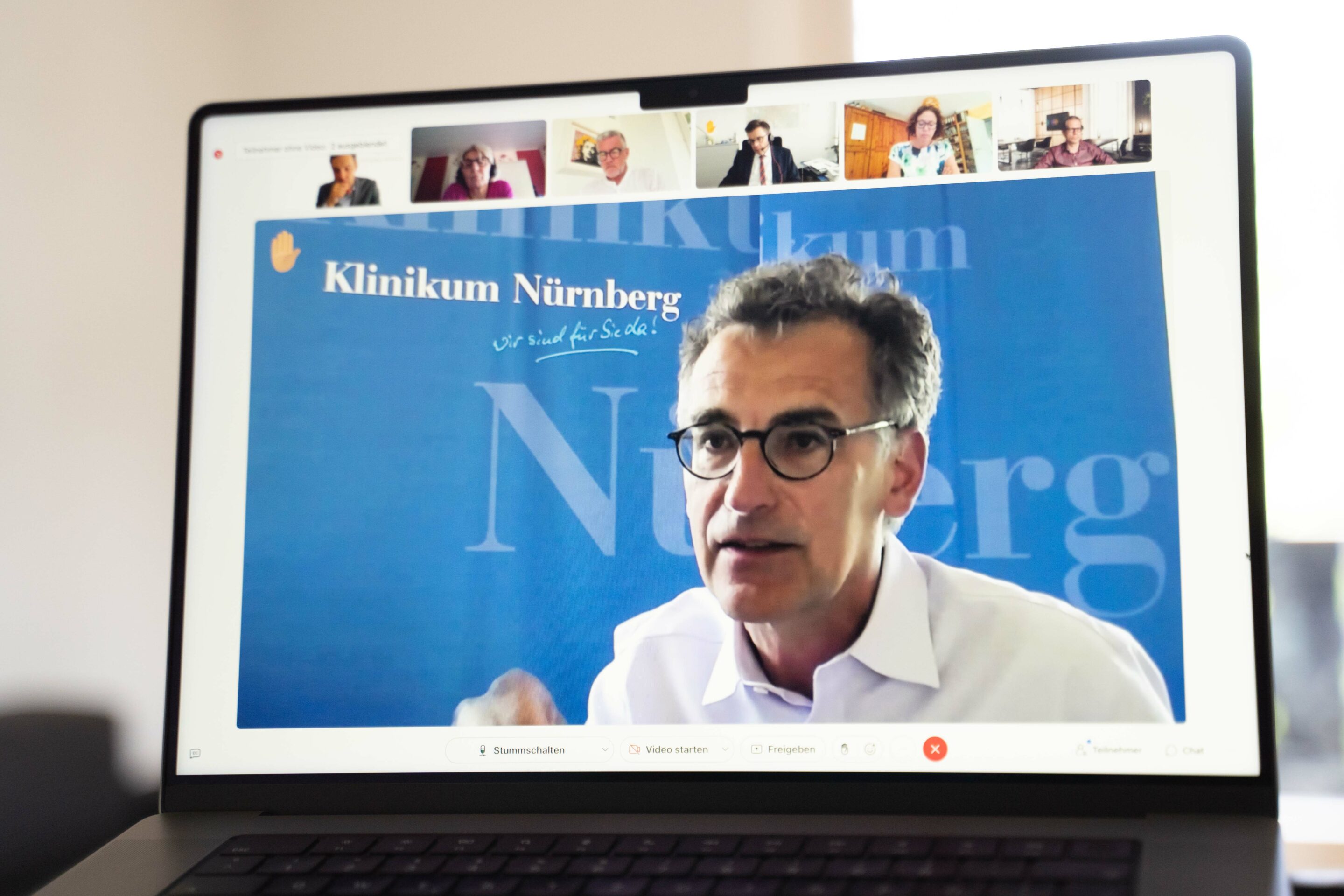
Ein Teilnehmer der Runde war ebenfalls überzeugt, dass nur die Krankenhäuser über die Organisationskraft und das Volumen verfügen, um die Nachversorgung zu organisieren. Man könne für ein Krankenhaus berechnen, wie viel ein Patient kostet, wenn er zu lange im Krankenhaus bleibt. Dieses Geld könne das Krankenhaus verwenden, um das Problem zu lösen und zum Beispiel Pflegebetten einzurichten. Doch nach Meinung eines weiteren Teilnehmers würde dies nicht funktionieren. Denn zum einen seien auch für diese Betten in den Kliniken kein Personal vorhanden. Zum anderen sei die Umwandlung eines Krankenhausbettes in ein Pflegebett aufgrund der gesetzlichen Vorgaben nicht ohne weiteres möglich. Doch stimmte er dem Vorschlag zu. Er würde nun eine ambulante Struktur aus Pflegekräften, Therapeuten und „Kümmerern“ aufbauen, um die Versorgung nach der Entlassung zu gewährleisten. Dies würde zwar nicht refinanziert, das sei für ihn aber nicht die entscheidende Frage. Sondern, ob dadurch eine substanzielle Entlastung der stationären Betten erreicht werden kann.

Verantwortung auf Kommunen und Gemeinden übertragen
Insgesamt müssten die ambulanten Strukturen, gerade in der Vor-, aber auch der Nachsorge besser werden, damit die Versorgung zu Hause so lange und so gut wie möglich gewährleistet ist. Sonst werden weiterhin die teuren und knapper werdenden Ressourcen in den Kliniken vergeudet. Ein Beispiel seien Patienten, die als Therapie zweimal am Tag ein Antibiotikum intravenös bekommen müssen. Dies könnte zu Hause gemacht werden. Doch in Deutschland ist bei solchen Patienten ein stationärer Aufenthalt nötig, weil es ambulant nicht organisiert ist. Einige Teilnehmer forderten, die Verantwortung an die Kommunen und Gemeinden zu übertragen. Diese wüssten am besten über die Bedarfe und Gegebenheiten vor Ort Bescheid.

Hoher bürokratischer Aufwand führt zu Unzufriedenheiten auf allen Seiten
Durch die Patienten, die ohne Notwenigkeit weiter in den Kliniken versorgt werden, entsteht neben den Kosten auch ein hoher bürokratischer Aufwand durch die MD-Prüfungen und die Rücksprachen mit den Krankenkassen. „Das macht keinem der beteiligten Spaß“, resümierte ein Diskutant. Ein Teilnehmer der Runde machte hier die untere Grenzverweildauer als großes Hindernis verantwortlich. Sie sei aus Patientenschutzgründen eingeführt worden. Aber die Medizin habe sich weiterentwickelt und kein Krankenhaus würde einen Patienten blutig entlassen. Deshalb sei dieser Patientenschutzaspekt hinfällig, und, wie er unterstrich, ein häufiger Grund für finanzielle Auseinandersetzungen: „Das ist eher ein Hindernis, verstopft die Akuteinrichtungen und heizt die Problematik zusätzlich an.“

Personalmangel als Ursache des Problems
Doch gibt es die Abverlegungsproblematik überhaupt? Einige Teilnehmer der Runde waren der Meinung, dass die Daten bei MD und bei den Krankenkassen seit Jahren unverändert seien. Zu beobachten sei dagegen eine Fallzahlabnahme und ein erhöhter Aufnahmedruck. Das eigentliche Problem sei der Personalmangel: die nach dem Klinikaufenthalt nötigen Institutionen haben ebenso wie die Kliniken zu wenig Personal, sodass die Aufnahme nicht möglich ist. Und dieses Problem steht erst am Anfang. Der Mangel an Fachpersonal, der bereits spürbar ist, sei erst die erste Stufe der Folgen des demografischen Wandels und die in zehn Jahren mit voller Wucht zum Tragen kommen. „Den demografischen Wandel können wir aber nicht aufhalten“, so der Teilnehmer, „bisher konnten wir die Probleme mit Geld lösen, aber das geht dann nicht mehr.“ Umso wichtiger ist es, über effiziente Versorgung nachzudenken. Dies, so waren die Diskussionsteilnehmer überzeugt, müsse mit in die laufende Krankenhausreform integriert werden. „Und die Versorgung muss endlich vom Patienten her gedacht und organisiert werden“, forderten einige Diskutanten.
Ein Teilnehmer der Runde kritisierte: „Es gibt keinerlei Verzahnung zwischen akutstationärer Einrichtung und allen anderen Dingen, die der Patient benötigt und das ist eine einzige Katastrophe. Dann bleibt nur das Krankenhaus, das alles vorhalten muss. Und das Krankenhaus bezahlen wir teuer. Die Problematik ist seit Jahrzehnten bekannt und es ist erstaunlich, dass man in der Medizinlandschaft ein so simples Problem nicht lösen kann.“ Die Krankenhausreform sei ein guter Ansatz, um endlich regionale Netzwerke aufzubauen. Und endlich die zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen, um die Versorgung vom Patienten aus aufzubauen.









