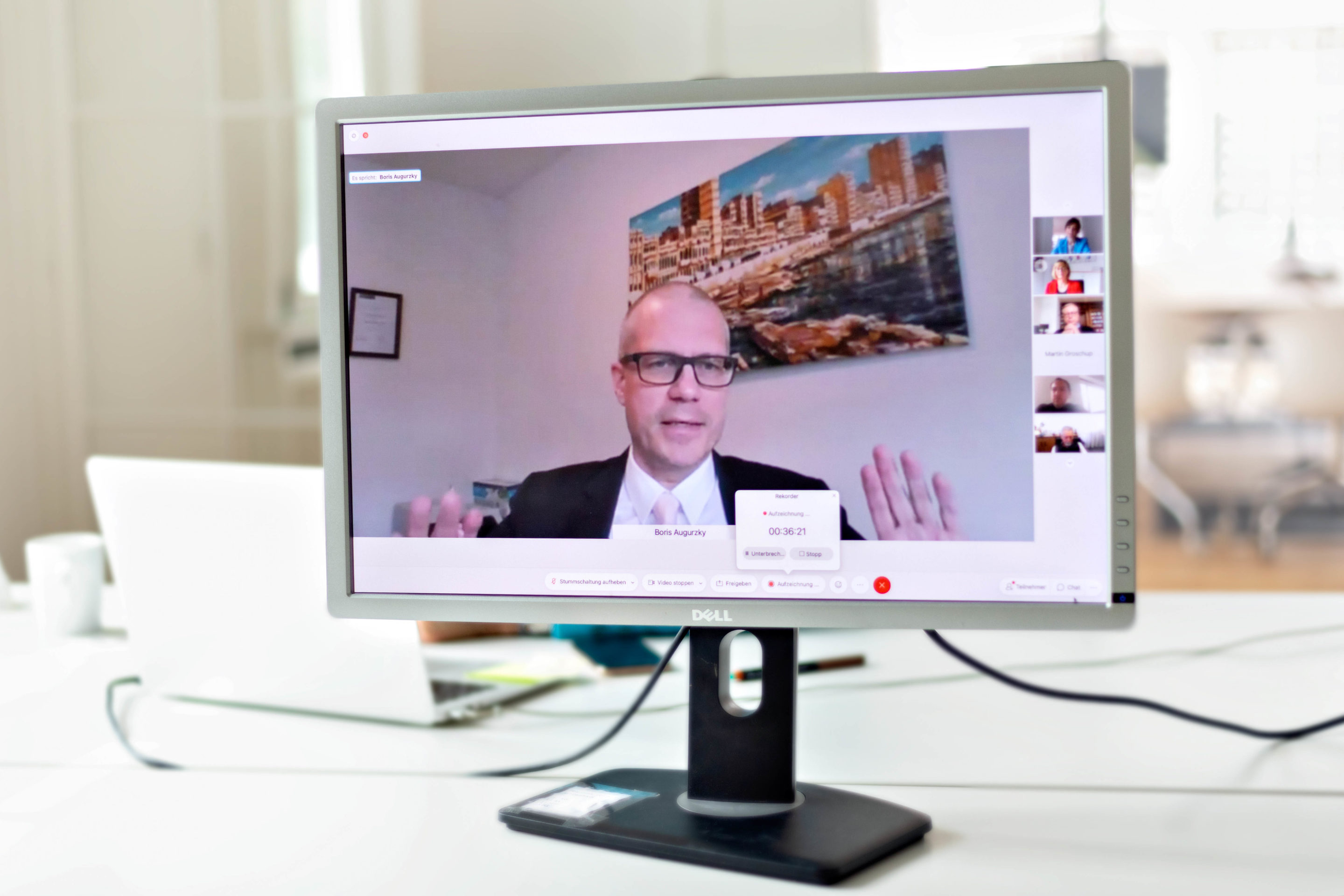Auch wenn wir noch mitten in der Pandemie stecken, die Infektionszahlen schwindelerregend hoch und die Meldungen der Intensivstationen teilweise beängstigend sind: Dank der schnell entwickelten Impfstoffe ist ein Ende ist in Sicht.
Doch wir haben miterlebt, dass immer wieder neue Probleme auftreten, die schnelle Entwicklungen in der Medizin bremsen. Zum Teil nachvollziehbar, überwiegend jedoch unverständlich und strukturell bedingt. „Die Pandemie war ein Stresstest für die öffentliche Verwaltung, den sie nicht wirklich bestanden hat“, fasste es ein Teilnehmer der Diskussion zusammen. Was können wir also tun, um auf künftige Pandemien besser vorbereitet zu sein? Beim Auftreten neuer Erreger schneller und zielgerichteter zu reagieren? Darüber diskutierten die Teilnehmer des zweiten Luncheon Roundtable-Gesprächs der Stiftung Münch im April:
Zu den Teilnehmern gehörten:
- Thomas Ballast, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Techniker Krankenkasse
- Prof. Martin Groschup, Leiter des Instituts für neue und neuartige Tierseuchenerreger, Friedrich Löffler Institut
- Dr. Susanne Johna, Vorsitzende des Marburger Bund, Pandemiebeauftragte der Bundesärztekammer
- Dr. Daniel Kalanovic, Medical Lead und Managing Director, Pfizer Deutschland
- Dr. Markus Müschenich, Managing Partner bei Eternity.Health und Expert Partner bei Heal Capital
- Prof. Wolfgang Streit, Abteilungsleiter Mikrobiologie & Biotechnologie, Universität Hamburg
sowie von der Stiftung Münch Professor Boris Augurzky (Vorstandsvorsitzender), Eugen Münch (stv. Vorstandsvorsitzender), Dr. Johannes Gruber (Geschäftsführer, Syndikus) und Annette Kennel (Operative Geschäftsführerin).
Vorbereitung ernst nehmen und Pläne realisieren
Es scheint, als habe uns die Corona-Pandemie völlig unvorbereitet getroffen. Seit ihrem Beginn sind unzählige Diskussionen geführt, Pläne entwickelt, angepasst, verworfen, und neu aufgesetzt worden. Insbesondere die Gesundheitsämter, die bis dahin ein Schattendasein gefristet haben, sind zu großer Bekanntheit gelangt. Hier wurden Missstände offensichtlich, die nicht mehr in die Zeit passen: Daten werden händisch erfasst, in Computer eingetippt und per Fax weitergereicht; beteiligte Institute sind unzureichend digital vernetzt. In der Folge kann auf wichtige und entscheidungsrelevante Informationen nur verzögert oder unvollständig zugegriffen werden.
Dabei gab es einen vom Robert Koch-Institut entwickelten nationalen Pandemieplan von 2017. Entwickelt vor allem, um für eine potenzielle Influenza-Pandemie gewappnet zu sein, aber übertragbar auch für Pandemien durch andere Erreger. Der Plan wurde vom BMG genehmigt und das RKI mit der Umsetzung beauftragt. Ein Teil davon: die Weiterentwicklung des elektronischen Meldesystems Demis.
Der Plan wurde nicht umgesetzt.
Auch im Sommer 2020, in dem die Infektionszahlen niedrig waren, wurde die Zeit zum Durchatmen statt zur weiteren Vorbereitung genutzt, wie es ein Teilnehmer formulierte. Ein Fehler, denn so wurde mit Beginn der dritten Welle ab November erneut wenig koordiniert und wieder unvorbereitet gehandelt. Dieser Fehler dürfe sich nicht mehr wiederholen, forderten mehrere Teilnehmer der Diskussion. Man müsse vermeiden, sich nach der Coronapandemie nur erleichtert zurückzulehnen, sondern müsse ernsthaft Pläne entwickeln. Und die Maßnahmen dann auch umsetzen. „Die Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes zähle ich dabei zu den Maßnahmen, die einfach umsetzbar sind“, betonte ein Diskutant, „denn da wissen wir ja, was wir brauchen.“


Woher droht Gefahr? Erreger frühzeitig kennen
Ein Ansatz, um neuen Pandemien vorzubeugen, ist die frühzeitige Identifizierung von neuen Krankheitserregern. Dabei spielen sowohl Viren als auch Bakterien eine Rolle. Bereits existierende Erreger können sich verändern und so pathogen werden – durch schädliche Mutationen oder durch eine Erweiterung ihrer Verbreitung. Werden sie zum Beispiel über tierische Wirte übertragen, die neue Lebensräume einnehmen, werden dort Krankheiten endemisch, die vorher nur in anderen Regionen vorkamen. Auch Zoonosen, also Erreger, die von Tieren auf Menschen übertragen werden und dort Krankheiten auslösen, müssen weiter erforscht werden.
Dass die Umwelt sich verändert, wirkt sich auch auf das Infektionsgeschehen aus. „Eine Konsequenz daraus ist, dass die Hygiene- und Umweltmedizin eine viel wichtigere Rolle spielen muss“, forderte ein Diskutant. Aktuell seien jedoch zum Beispiel in Hessen nur vier solche Fachärzte tätig, ihr Durchschnittsalter liege bei über 60 Jahren. „Hier besteht dringender Handlungsbedarf“, forderte der Teilnehmer. Die Veränderungen der Erreger durch die Veränderungen in der Umwelt müsse wissenschaftlich begleitet und als Thema der globalen Gesundheitspolitik, mindestens jedoch auf europäischer Ebene, angegangen werden.
Dabei, so ein Diskutant, gebe es auch ganz einfach und schnell umzusetzende Maßnahmen mit großer Wirkung. Er führte als Beispiel die zunehmende Problematik von Antibiotikaresistenzen auf, die durch den zu häufigen und oft unnötigen Einsatz der Antibiotika entstehen. In vielen Ländern der EU können Antibiotika noch von jedermann einfach in der Apotheke erstanden werden – eine durchgängige Verschreibungspflicht würde also viel bewirken.

Zulassung neuer Wirkstoffe: Schnellere Wege verstetigen
Ist erst einmal ein neuer pathogener Erreger in der Welt, gibt es zur gezielten Bekämpfung zwei Möglichkeiten: Impfen zur Vorbeugung und wirksame Medikamente zur Therapie. Die Corona-Pandemie hat deutlich vor Augen geführt, dass Forschung und Entwicklung schnell Ergebnisse gebracht haben. „Es war sicher ein Glücksfall, dass die mRNA-Technologie genau zu dem Zeitpunkt ausgereift war“, so einige Teilnehmer. Allerdings kein Zufall, denn an neuen Technologien wurde seit geraumer Zeit geforscht. „Im Prinzip hatten wir nach ein paar Tagen schon geeignete Wirkstoffkandidaten“, so ein Teilnehmer des Gesprächs, „an denen wurde noch modelliert, aber im Sommer war klar, welche in Frage kommen.“ Sowohl die Entwicklung von Impfstoffen als auch von Medikamenten gegen verschiedene Erkrankungen, Stichwort personalisierte Medizin, werde in Zukunft immer schneller und immer effizienter gehen.
Die Zulassung dagegen gestaltete sich als schwierig. „Wenn wir schneller Wirkstoffe haben, müssen wir das Vorgehen in den Zulassungsbehörden darauf einstellen und verstetigen“, forderte ein Diskutant. Es könne nicht mehr sein, dass Anträge grundsätzlich erst einmal drei Monate liegen, bevor sie bearbeitet werden, das sei schlicht nicht mehr vermittelbar. Hier müssten neue Regeln eingeführt werden, die auch die neuen Möglichkeiten der Wirkstoffentwicklung berücksichtigen und eine schnellere Prüfung der Zulassung erlauben, insbesondere auch für mutationsbedingte Anpassungen am Impfstoff.
Ein weiterer Engpass in der Coronapandemie war die Produktion des neuen Impfstoffes. „Wenn wir in Europa in der Lage sein wollen, große Mengen eines Impfstoffes oder Medikaments zu produzieren, müssen wir Vorhaltekosten in Kauf nehmen“, sagte ein Teilnehmer des Gesprächs. In den letzten 20 Jahren habe man nur nach der günstigsten Möglichkeit geschaut, die immer außerhalb Europas lag. „Das führt jetzt zu Problemen und das müssen wir künftig ändern“, so die Forderung.

Reaktionszeit beschleunigen durch kollektive Intelligenz: „Wir brauchen eine Art breiter aufgestellten Karl Lauterbach“
Um die Reaktion auf das dynamische Infektionsgeschehen zu beschleunigen, müsste die kollektive menschliche Intelligenz zunächst mehr genützt werden, forderte ein Teilnehmer. „Wir tun uns schwer, wissenschaftlichen Konsens zu finden und haben stattdessen viele Einzelmeinungen“, legte er dar. Es müssten Experten verschiedener Disziplinen vernetzt werden, die regelmäßig alle Fakten zusammentragen, bewerten und daraus im Konsens einen Ratschlag formulieren. „Damit hätten wir eine Netzwerkintelligenz, die erlaubt, jenseits der Talkshows Kompromisse zu finden“, so ein Diskussionsteilnehmer. Ein anderer Teilnehmer verglich das, was man dringend brauche, mit „einer Art Leopoldina on speed“ oder „einem breiter aufgestellter Karl Lauterbach.“
Im Kleinen gibt es solche Runden, wie zum Beispiel die Corona-Task Forces, die an einzelnen Kliniken eingerichtet werden. Auf nationaler Eben fehlen sie. Dass mit ihnen die Reaktionszeit beschleunigt würde, zeigt das Beispiel Australien. Dort trägt eine Covid19 Task Force jede Woche Literatur zusammen, wertet sie aus und zieht Schlussfolgerungen. „Soziologische, medizintheoretische und dynamische Verfahren, um Experten zu vernetzen, wären auch für künftige Pandemien eine wichtige Vorbereitung“, zeigten sich mehrere Teilnehmer überzeugt.

Unternehmen, Staat oder unabhängige Kontrollinstanz: Was ist für eine erfolgreiche Zusammenarbeit nötig?
In der Krise habe sich gezeigt, dass Lösungen überwiegend aus Unternehmen kamen, oder, wie es ein Teilnehmer der Runde formulierte: „Wenn man die Kuh vom Eis kriegen will, klappt das nur über die private Wirtschaft, da versagt der Staat.“ Wäre eine unabhängige Instanz nötig, um Wirtschaft und Staat zu verknüpfen? Zum Beispiel wie die von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek im April dieses Jahres angekündigte Agentur, die im laufenden Jahr mit 50 Millionen Euro ausgestattet ihre Arbeit aufnehmen soll, um die vom Staat gesetzten Ziele mit Hilfe von Wissenschaftlern umzusetzen?
Grundsätzlich bewerteten einige Teilnehmer des Gesprächs den Ansatz positiv, eine unabhängige Institution an der Schnittstelle zwischen Unternehmen, Forschung und Staat zu installieren. Politik sollte Regeln vorgeben, die Umsetzung von der privaten Wirtschaft durchgeführt und von dieser neuen Institution kontrolliert werden, wie eine Art „Zentralbank“. Dafür ist aber der unternehmerische Ansatz unabdingbar, meinte ein Teilnehmer: „Die Europäische Zentralbank macht ja auch nur Sinn, wenn erfolgreiche Banken mit Gewinnabsicht dahinterstehen.“ Politik, Patienten und gewinnorientierte Unternehmen müssten auf ethischer Basis in ein Gleichgewicht gebracht werden.
Für die schnellere Verfügbarkeit neuer Wirkstoffe wären zudem dringend neue Arten der Zusammenarbeit zwischen Staat und Unternehmen nötig. Bisher liegt bei der Erforschung von Medikamenten oder Impfstoffen das gesamte finanzielle Risiko beim Unternehmen. „In anderen Ländern ist es üblich, dass der Staat unterstützt und das Risiko geteilt wird“, erläuterte ein Teilnehmer. Das sei auch in Deutschland dringend geboten.

Künstliche Intelligenz – kann sie helfen?
„Wir haben noch nicht mal die Möglichkeiten der menschlichen Intelligenz ausgeschöpft“, bemerkte ein Teilnehmer der Diskussion. Dennoch besteht mit der Anwendung künstlicher Intelligenz ein Werkzeug, das in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt und die Pandemiebekämpfung verbessern kann.
Bei der Entwicklung neuer Wirk- und Impfstoffe oder bei der Identifizierung neuer Erreger wird KI bereits eingesetzt. Und auch für die Vorhersage der Verbreitung des Virus kann sie helfen. „Bisher laufen wir der Pandemie hinterher und reagieren nur“, so ein Teilnehmer. Doch aus der Tiermedizin weiß man, dass nur erfolgreich ist, wer alle Informationen darüber hat, wo die Seuche gerade auftritt. „Man muss vor die Seuche kommen, Nachverfolgung ist eigentlich schon zu spät“, fasste er zusammen. Dazu braucht es Frühwarnsysteme. Um sie zu etablieren, müssen kontinuierlich Informationen gesammelt werden: „Wir brauchen Daten, Transparenz, Sammlung und Verknüpfung“, summierte es der Diskutant. Die Mittel, die dafür erforderlich sind, wären letztlich auf viele Pandemien und Infektionsgeschehen übertragbar, also zur Vorbereitung gut geeignet.
Bisher ist immer noch unklar, warum manche Menschen einen schweren Krankheitsverlauf haben oder „Long-Covid“ entwickeln. Die Impfreihenfolge orientiere sich nach grob ermittelten Risikoklassen, insbesondere nach Alter. DeepMind, die Google KI, wurde ursprünglich trainiert, anhand des Augenhintergrunds Diabetes zu diagnostizieren. Plötzlich konnte sie zusätzlich und verlässlich erkennen, ob das untersuchte Bild von einer männlichen oder weiblichen Person stammte. „Woher sie das wusste – keine Ahnung. Aber sie wusste es“, so ein Diskutant. Ähnliches könnte geschehen, um Faktoren für einen schweren Verlauf von Covid19 zu entdecken. „Diese Chance muss unbedingt genutzt werden“, forderte er. Hier seien auch die Ärzte gefordert, einzugestehen, dass sie nicht alles können und das Auswerten von Publikationen an Grenzen stößt – und die KI ein hilfreiches Werkzeug ist. Dazu wiederum ist eine Verbesserung der digitalen Kompetenzen des Berufsstands nötig.
Damit die KI ausreichend Daten hat, sollte schlicht von jedem Coronapatienten eine Referenzprobe in ein Labor geschickt werden. Die Erkenntnis, dass Daten für Forschung besser genutzt werden müssen, ist nicht neu; in der Pandemie jedoch erneut klar geworden – und sollte durch gesetzliche Regelungen auch für künftige Pandemien unbedingt verankert werden.