Innovative Produkte und Medikamente, die die Gesundheitsversorgung verbessern können – an Ideen mangelt es nicht. Doch Startups, Unternehmen und Wissenschaftler, die ihre Ideen ins System bringen wollen, stehen vor vielen Problemen. „Man will Neuerungen, aber dann kommt der bürokratische Apparat“, formulierte es ein Teilnehmer der Diskussionsrunde. Langwierige Zulassungsverfahren, verschiedene Zuständigkeiten, wiederholt erforderliche Anträge – die Hürden sind vielfältig und hoch. Wo liegen die Schwierigkeiten? Und wie kann es gelingen, die Einführung von Innovationen in die Versorgung zu erleichtern? Darüber diskutierten die Teilnehmer des Luncheon Roundtables der Stiftung Münch im Februar.
Zu den Teilnehmern gehörten:
- Barbara Diehl, Chief Partnership Officer, SPRIN-D – Bundesagentur für Sprunginnovationen
- Dr. Daniel Kalanovic, Country Medical Director, Pfizer Pharma GmbH
- Dr. Wiebke Löbker, Leiterin der Stabsstelle Innovationsbüro/Changemanagement, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)
- Dr. Sierk Pötting, Operativer Geschäftsführer, BioNTech AG
- Julian Specht, Gründer und Chief Scientific Officer, livingbrain
- Prof. Dr. Claus Zippel, Professur für Betriebswirtschaftslehre und Management im Gesundheitswesen, Katholische Hochschule Mainz
sowie von der Stiftung Münch Professor Boris Augurzky (Vorstandsvorsitzender), Eugen Münch (Stv. Vorstandsvorsitzender), Professor Bernd Griewing (Vorstand), Professor Andreas Beivers (Leiter wissenschaftliche Projekte) und Annette Kennel (Geschäftsführerin).
Beschleunigung ohne Qualitätsverlust
„Gut Ding will Weile haben“ – nach diesem Motto läuft nach wie vor die Zulassung für medizinische Innovationen. Dabei hätte mehr Tempo – ohne Abstriche bei der Qualität – einige Vorteile für Patienten, die schneller von den Neuerungen profitieren könnten.
Dies hat nicht zuletzt die Pandemie deutlich vor Augen geführt. In dieser Zeit wurden neue Wege ermöglicht und beschritten. Bei Entwicklung und Zulassung sowohl des neuartigen mRNA-Impfstoffs als auch eines Medikaments zur Behandlung von Covid 19 setzten die beteiligten Unternehmen mit dem Projekt „light speed“ auf massive Beschleunigung: „Wir wollten keine roten Ampeln überfahren, aber unter den geltenden Regeln so schnell wie möglich sein“, fasste ein Teilnehmer der Runde zusammen. Die sonst nacheinander abgearbeiteten, langwierigen Schritte bei der Zulassung wurden parallel gestartet. Mit dem Erfolg einer rasanten Verfügbarkeit einer neuen Impfung und nun eines Medikaments – zum Wohle der Bevölkerung.
Um schneller zu werden, wurde auch vor gut einem Jahr der „DiGa-Fasttrack“ beim BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) ins Leben gerufen, der es ermöglichen soll, digitale Gesundheitsanwendungen schneller auf den Markt zu bringen. Ein beachtlicher Schritt, mit dem Deutschland zum Vorreiter wurde – allerdings nur in einem kleinen Teilbereich.
Wie kann Fahrt aufgenommen werden?


Ein Antrag, eine Bewilligung
Ein großes Problem bei der Einführung von Innovationen, so waren die Teilnehmer der Diskussion einig, sei die Kleinteiligkeit in Deutschland und uneinheitliche Regelungen. „Manchmal gibt es Vorgaben vom Bund, dann ist das Land zuständig, aber teilweise kann es sich bis zur Kommunalebene ziehen“, so ein Teilnehmer. Deshalb müsste oft ein und derselbe Antrag bei verschiedenen Stellen immer wieder neu eingereicht und begutachtet werden.
Als Beispiel wurden die Zustimmung der Ethikkommissionen und Datenschutzregelungen genannt, die Voraussetzung für die Durchführung von multizentrischen Studien sind. Gibt die Ethikkommission einer beteiligten Universität ein positives Votum, gilt dieses nicht an einer anderen Universität – hier muss für dieselbe Studie erneut ein Antrag vorgelegt und beschieden werden. „Man fängt also jedes Mal wieder von vorne an. Und zwischen Einreichen und Entscheidung liegen oft etwa neun Monate“, schilderte ein Teilnehmer, „dabei kann man doch davon ausgehen, dass die Kriterien, nach denen die Mitglieder entscheiden, nicht grundsätzlich verschieden sind.“ Der Faktor Zeit ist insbesondere für Startups ein Problem und, so ein Diskutant, würde dazu führen, dass bei der Entwicklung mancher Produkte auf die Durchführung von klinischen Studien und die Zulassung als Medizinprodukt verzichtet wird. „Das geht dann auf Kosten der Qualität“, betonte er. Analog verhält es sich mit dem Datenschutz, bei dem jeweils die einzelnen zuständigen Landesdatenschutzbeauftragten involviert werden müssen.
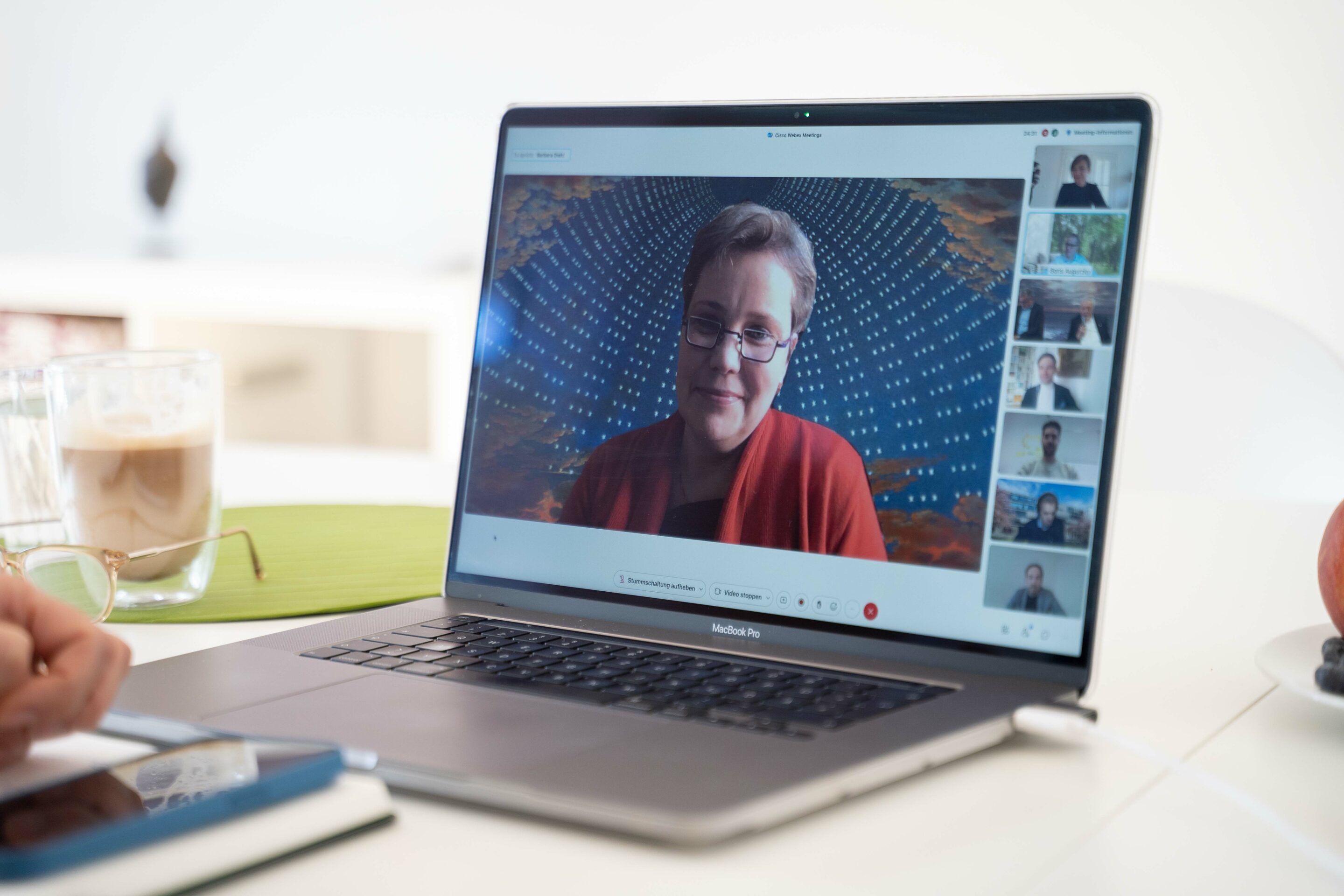

Hier besteht nach Meinung der Diskutanten erhebliches Potenzial: Ein positiver Bescheid einer Ethikkommission sollte generell gültig sein und die Datenschutzverordnung unbedingt vereinheitlicht werden. So könne eine Verkürzung der Innovationszyklen erreicht werden, ohne dass die Qualität darunter leide. Ein Teilnehmer schlug vor, anderen Kommissionen ein Vetorecht einzuräumen, so dass eine Kontrollmöglichkeit eingebaut wäre.
Ansprechpartner und Vertragsmuster: Professionelle Schnittstellen an Forschungseinrichtungen etablieren
Ein weiteres Problem bei der Durchführung von Studien scheint banal: „Die großen Forschungszentren sind nicht so organisiert, dass man einfach Kontakt für eine Kooperation aufnehmen kann“, so ein Teilnehmer. An den Universitäten herrsche eine Lehrstuhlmentalität, der Kontakt laufe über die einzelnen Abteilungen – diese werden nicht als ein Institut zusammen gedacht, sondern agieren jeweils eigenständig. Damit fehlen professionelle Schnittstellen, um die korrekten Ansprechpartner zu erreichen. „Das ist eine „low hanging fruit“, wäre einfach lösbar und würde schon viel helfen, um die klinische Forschung zu erleichtern“, so ein Diskutant.

Ein Teilnehmer regte zudem an, eine Infrastruktur zu schaffen, die Lösungen für die klassischen administrativen Fragestellungen bereitstellt, die für künftige Projekte als Vorlage dienen. Musterverträge für Kooperationen, IT- und Rechtsfragen, Datenschutzklauseln, Aufteilung von IP-Anteilen – all das könnte man aufsetzen und verfügbar machen. „Dann muss nicht jeder wieder von vorne anfangen, sondern kann gleich loslegen“, so ein Teilnehmer.

Wissenschaft versus Unternehmertum: Umdenken nötig
Jedoch, so waren einige der Diskussionsteilnehmer überzeugt, liegen die Verzögerungen auch nicht selten an den Innovatoren. „Oft überfrachten die sich mit wissenschaftlichen Fragen, statt kleine Schritte zu gehen und sich darauf zu fokussieren, was sie für die nächste Stufe brauchen“, so ein Diskutant. Ein anderer Teilnehmer betonte: „Bei vielen Sachen stehen sich die Firmen selbst im Weg, weil sie im Kopf Sicherungen eingebaut haben“, meinte er, „sie machen sich Sorgen um die Finanzierung und um ihr Ansehen: was, wenn ich einen Fehler mache?“ Damit seien sie gefangen in einem Sicherheitsdenken, aus dem sie nur schwer herauskämen.
Ein weiteres Umdenken sahen Teilnehmer der Runde auch bei Studierenden und Wissenschaftlern nötig. Oft werde der Wechsel von der Wissenschaft in das Unternehmertum noch als „Abstieg“ empfunden.

Zudem sei das Wissen, wie Forschungsergebnisse in Anwendungen transferiert werden können, nicht ausgeprägt und auch nicht Teil des Curriculums etwa beim Medizinstudium. Dies zu ändern, wäre zu langwierig. Aber man könnte, so schlug ein Diskutant vor, verstärkt für das Thema sensibilisieren. Dazu gehöre, darauf hinzuweisen, dass Forschungsergebnisse nicht zu früh publiziert werden sollten, da sie sonst nicht mehr patentierbar sind. Insgesamt müssten mittelfristig die Aufstiegschancen im akademischen Bereich anders ausgerichtet werden. Bisher spielt dabei der so genannte Impact factor der Publikationen als Beleg für den wissenschaftlichen Erfolg eine wichtige Rolle. Da eine Publikation mit einem geringeren Risiko verbunden ist als das Nachverfolgen einer neuen Idee, wird die Gründung eines Unternehmens oft nicht weiterverfolgt. Deshalb sollten auch Forscher, die ihre Ergebnisse in die Praxis bringen wollen, gefördert werden und Karriereoptionen haben.

Freiräume als Schutzzonen für Innovationen schaffen
Ein Teilnehmer der Diskussion schlug vor, „Freiräume“ für Innovationen zu entwickeln. Da aus anderen Bereichen bekannt sei, dass die Versuche des Abbaus von Bürokratie reihenweise scheitern, sei es in seinen Augen nicht realistisch, dies im Gesundheitssystem für die Etablierung von Innovationen hinzubekommen. Er verwies auf das Insolvenzrecht, das es Unternehmen ermögliche, sich von vielen Vorgaben zu lösen und damit mehr Handlungsfreiheiten zu bekommen. In diesem Sinne könnte ein fiktiver Freiraum für Innovationen geschaffen werden, in dem die Gesellschaft ihre Schutzfunktionen zurücknimmt und das Ausprobieren und Entwickeln zulässt. So könnte zum Beispiel für diesen Raum eine besondere Maßgabe für den Datenschutz gelten, die es bei Zustimmung des Probanden erlaubt, Lösungen auszutesten. Würde sich die neue Idee gut entwickeln, kann sie in den „Normalbereich“ überführt werden.

Pandemie als Innovationsbeschleuniger: Den Elan mitnehmen
Ein Teilnehmer wies auf ein Konzept aus der Erziehungspsychologie hin, das zwischen dem „growth mindset“ und dem „fixed mindset“ unterscheidet. Während das fixed mindset davon ausgeht, dass Menschen mit nicht veränderbaren Eigenschaften geboren werden, vertritt das growth mindset die Auffassung, dass Menschen sich entwickeln, experimentieren und lernen. In Normalsituation tendieren wir dazu, Dinge als gegeben anzusehen und nicht verändern zu können. Doch die Pandemie, so ein Teilnehmer, war ein großes Realexperiment. In dieser Ausnahmesituation mussten Dinge geschehen und schnell verändert werden. „Es hat sich gezeigt, wie veränderbar wir sind und auch welche Veränderungen möglich sind“, so der Diskutant.

„Die Pandemie hat begünstigt, dass alle an einem Strang ziehen“, unterstrich ein weiterer Teilnehmer, „es gab keine Partikularinteressen mehr, die Behörden haben mitgemacht und die Schranken im Kopf waren ausgesetzt“. So konnte sehr viel in sehr kurzer Zeit erreicht werden. Er betonte: „Das kann auch andere inspirieren.“ Dies sollte beibehalten und institutionalisiert werden. Darunter falle zum Beispiel der frühe Kontakt zu den Behörden, eine höhere Risikobereitschaft und mehrere Schritte parallel zu gehen. „Wir sollten diesen Elan und diese Flexibilität aus der Pandemie mitnehmen“, forderte er.










