Die elektronische Patientenakte (ePA) muss seit Januar dieses Jahres verpflichtend allen gesetzlich Krankenversicherten angeboten und seit Juli auch von Leistungserbringern mit Informationen befüllt werden. Doch sowohl das Anlegen als auch das Befüllen muss aktiv vom Versicherten gefordert werden – eine strikte Opt-in-Regelung, die ein großes Hindernis für die erfolgreiche Implementierung sein kann und die es in anderen europäischen Ländern so nicht gibt. Sind dann Informationen in der ePA hinterlegt, gilt es, diese zu sichern. Dazu muss unter anderem genau geregelt werden, wer auf welche Dokumente Zugriff hat und wie lange dieser gewährt wird. Und auch hier gibt es unterschiedliche Lösungen in verschiedenen europäischen Ländern.
Die verschiedenen Wege der Länder bei der Anlage und beim Zugriffsmanagement der ePA haben eine Vorgabe gemeinsam: Sie müssen mit der Datenschutzgrundverordnung DSGVO konform gehen, die europaweit harmonisiert ist. Ob die DSGVO in den unterschiedlichen Ländern unterschiedlich gehandhabt wird, hat gerade Professor Christoph Krönke in einer Studie für die Stiftung Münch untersucht, die Ende Oktober erscheint.
Ist die Opt-in-Regelung ein Hindernis bei der Einführung der ePA? Ist das Zugriffsmanagement zu komplex? Wie sind die bisherigen Erfahrungen aus der Sicht von Leistungserbringern und Kostenträgern? Wo gibt es Nachbesserungsbedarf und was ist bei geltender DSGVO möglich? Darüber haben die Teilnehmer des Luncheon Roundtables der Stiftung Münch im September gesprochen.
Zu den Teilnehmern gehörten:
- Prof. Christoph Krönke, Universitätsprofessor für öffentliches Recht an der WU Wirtschaftsuniversität Wien
- Prof. Dieter Kugelmann, Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
- Dr. Thomas Pöppe, Geschäftsbereichsleiter Digitalisierung und IT bei der AOK Bayern
- Prof. Karl Stöger, Professor für Medizinrecht am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht Wien
- Prof. Petra Thürmann, Stellv. Ärztliche Direktorin am Helios Universitätsklinikum Wuppertal, Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen
- Dr. Helga Willinger, Leiterin der ELGA-Ombudsstelle Wien
sowie von der Stiftung Münch Professor Boris Augurzky (Vorstandsvorsitzender) und Annette Kennel (Operative Geschäftsführerin).
Seit 2021 haben alle Menschen in Deutschland die Möglichkeit, eine ePA zu erhalten. Bereit gestellt wird sie von ihrer gesetzlichen Krankenversicherung, befüllt auf Wunsch des Patienten von den behandelnden Ärzten. Schrittweise sollen die Möglichkeiten der ePA ausgebaut werden, also ab 2022 zum Beispiel den Impfpass oder den Mutterpass integriert haben. Die Zugriffe auf die einzelnen Dokumente können vom Inhaber der Akte ab 2022 ebenfalls feingranular freigegeben werden. Aktuell ist erneut ein Streit entbrannt: der Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung hat gerade die bundesweiten Krankenkassen aufgefordert, die Möglichkeit, einzelne Dokumente freizuschalten, auch wirklich ab 2022 umzusetzen. Außerdem müssten auch Patienten ohne ein Smartphone oder Tablet die Möglichkeit dazu haben.

Doch die ePA wird nur sehr schleppend angenommen. Daraus resultieren Probleme: Kommt nur etwa jeder 20. Patient mit einer ePA in die Praxis, können Ärzte keine Routine in der Handhabung entwickeln, was die Ablehnung befeuert. Und auch die gewünschten Effizienzen entstehen nur, wenn sie von vielen Menschen genutzt wird. „Wir müssen dringend raus aus der Pilotphase“, betonte ein Teilnehmer der Diskussion. Nur dann kämen Skalierungseffekte zum Tragen.

Befürworter der ePA mahnen deshalb dringend Änderungen an: „Der Zugang und Zugriff muss einfach und niederschwellig sein“, so ein Teilnehmer der Diskussion. Erreicht werden könnte das, wenn statt des Opt-in eine Opt-out-Regelung zur Anwendung käme: Dann hätten alle Menschen die Akte.

Wieso hat man sich für Opt-in entschieden?
Ein gängiges Argument ist, dass der Datenschutz die Opt-in-Regelung zur Anlage der Akte vorgebe und damit der Etablierung im Weg stehe. Doch in vielen anderen europäischen Ländern, wie zum Beispiel Spanien, Österreich und Estland, bekommen Versicherte die Akte automatisch und haben dann die Option, sich dagegen zu entscheiden, also mittels Opt-out die Akte in den virtuellen Papierkorb zu verschieben. In Österreich gibt es zudem den „situativen Opt-out“: Werden besonders sensible Daten wie zum Beispiel über eine HIV-Infektion oder eine Psychotherapie in die Akte eingespeist, muss der Inhaber darüber gesondert informiert und auf die Möglichkeit des Opt-out hingewiesen werden.

Der Grund für die Entscheidung zum Opt-in beruht in Deutschland auf einem verfassungsrechtlichen Ausgangspunkt und betont die informationelle Selbstbestimmung. „Damit soll die Selbstbestimmung und Entscheidungsfreiheit des Einzelnen gestärkt werden“, erläuterte ein Teilnehmer der Diskussion, „jeder Mensch bekommt die Möglichkeit, zu überlegen, ob er überhaupt will, dass seine Daten in die Akte gehen, und muss dem zunächst zustimmen.“ Die Betonung der informationellen Selbstbestimmung sei in Deutschland historisch gewachsen, daher hätte bei der Entscheidung für eine Opt-in-Lösung die Verfassungsrechtstradition eine starke Rolle gespielt. Dies sei jedoch keine datenschutzrechtliche Entscheidung und, wie ein Teilnehmer unterstrich, es sei auch die Frage, ob dies rechtlich zwingend sei.

Versorgungsperspektive: Patientensicherheit würde von Opt-out profitieren
Der Großteil der Teilnehmer sprach sich für eine Änderung aus – um den Zugang zu erleichtern und den Nutzen der ePA auszuschöpfen. Dies sei umso wichtiger, als praktische Erfahrungen aus dem Versorgungsalltag zeigen, wie oft Probleme durch fehlende Informationen auftreten. „Es wäre für die Patienten nicht nur angenehmer, sondern auch sicherer“, so ein Teilnehmer. Als Beispiel führte er an, dass multimorbide Patienten durchschnittlich einmal im Jahr in der Ambulanz eines Krankenhauses erscheinen. Auch wenn es seit 2016 das Recht auf einen Medikationsplan gäbe, hätten die meisten Patienten diesen nicht. Entsprechend ist nicht bekannt, welche Medikamente der eingelieferte Patient eingenommen hat. „Das ist nur ein Stückchen Information, aber die könnte manchmal lebensrettend sein“, betonte er. Und auch für jüngere und gesunde Menschen könne die ePA mit ihren Informationen schnell wichtig werden. „Diese Menschen legen vielleicht keine ePA an, weil sie denken, das brauche ich nicht“, so ein Diskussionsteilnehmer, „aber das kann sich ganz schnell ändern: Nehmen sie zum Beispiel eine Frau, die schwanger wird.“ Fazit: aus der Versorgungsperspektive wäre ein Opt-out wünschenswert.

Ein Teilnehmer führte aus, dass zwar bei der Entscheidung für einen Opt-out die informationelle Selbstbestimmung etwas zurückgestellt werde, man aber Möglichkeiten bei der Ausgestaltung hätte, um diese dennoch zu gewährleisten. Der Gesetzgeber könnte die Möglichkeiten regeln und ein Versprechen abgeben: Wenn zu einem späteren Zeitpunkt die Daten zu anderen Zwecken verwendet werden sollen, müssten auf Grund des informationellen Selbstbestimmungsrechts Schutzmechanismen greifen.

Gestufte Systeme: Leichter Zugang durch Opt-out, Opt-in für sensible Daten
Eine Lösung könnte also sein, mit gestuften Systemen zu arbeiten. „Dann kann man eher Richtung Opt-out gehen“, stimmten einige Teilnehmer der Runde zu. Opt-in sollte zum Tragen kommen, je sensibler und spezifischer die Daten seien. Notfalldaten würden unter eine Opt-out-Regelung fallen.
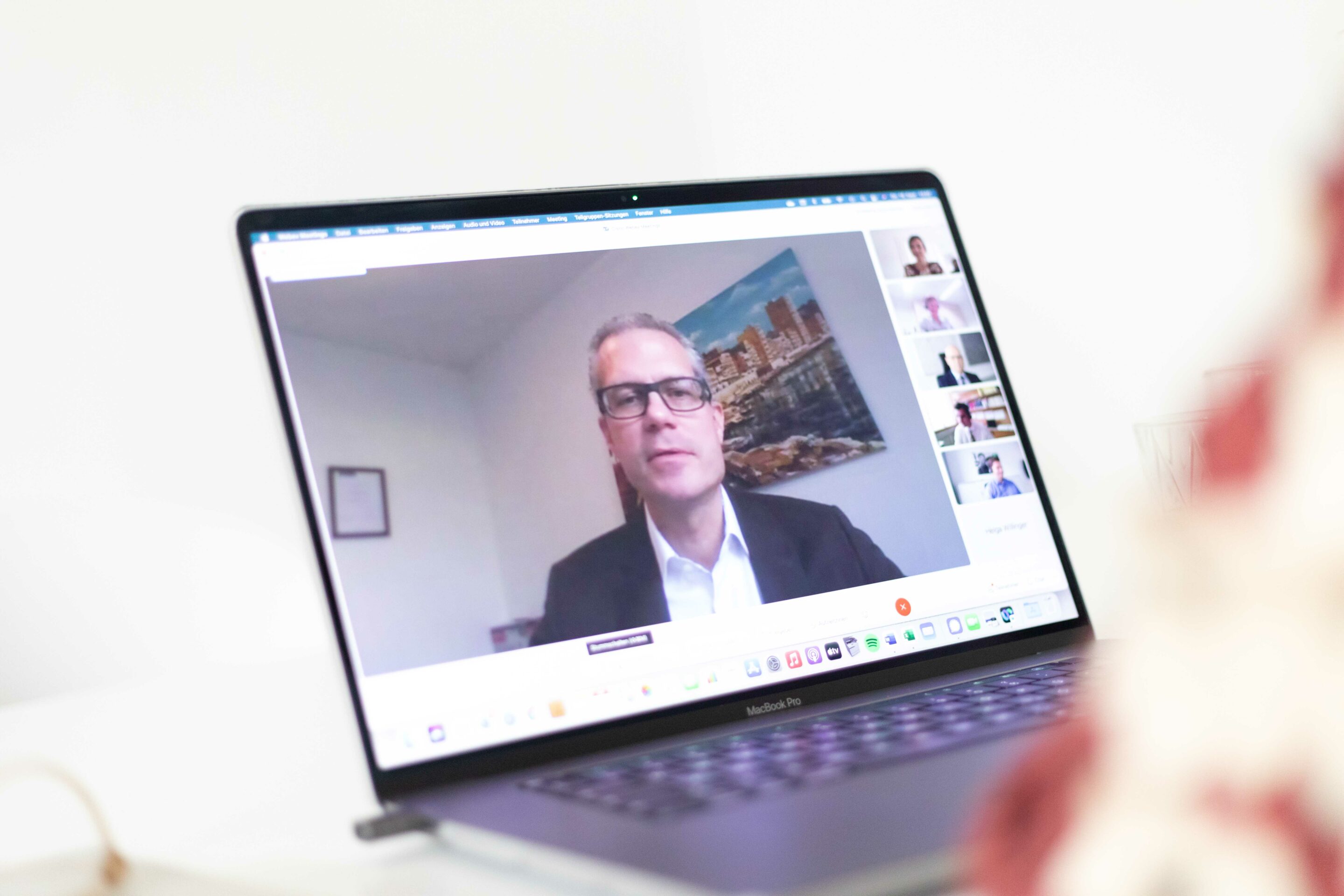
Auch sollte man unterschiedliche Regelungen bei den Daten für die Versorgung und den Daten für die Forschung treffen und diese getrennt behandeln. Der Einstieg in die Versorgung sei vorrangig und sollte leicht möglich sein, was durch Opt-out gelingen kann, so die Meinung mehrerer Gesprächsteilnehmer. Die Zustimmung zur Verwendung für Forschungszwecke sollte dagegen besser über ein Opt-in geregelt sein. Erfahrungen in Österreich hätten gezeigt, dass damit das Vertrauen in die Akte gestärkt wird. Denn gibt es ein opt-out bei der erstmaligen Anlage und Befüllung der Akte, sei es wichtig, das Versprechen zu halten, dass der Datenschatz nicht angetastet wird: „Das trägt maßgeblich zur Akzeptanz bei“, so ein Teilnehmer.

Zugriff auf die Dokumente
Die deutsche ePA sieht ab 2022 die Möglichkeit vor, einzelne Dokumente gezielt freizugeben und zu entscheiden, wer Einsicht nehmen darf. Auch hier muss der Inhaber der Akte aktiv werden. Aktuell ist dies in der Diskussion, da zum einen diese Möglichkeit derzeit nicht besteht. Zum anderen haben Menschen ohne ein Smartphone oder Tablet diese Möglichkeit nicht – was der Bundesdatenschutzbeauftragte bemängelt und die Krankenkassen zur Behebung aufgefordert hat. Hier sah wiederum ein Teilnehmer des Gesprächs ein Problem in der bisher geringen Akzeptanz der Akte: „Wir können für die wenigen Nutzer nicht in jeder Filiale einen Computer zur Verfügung stellen“, monierte er. Hier habe es geholfen, in enger Abstimmung mit dem Landesdatenschutzbeauftragten zu bleiben. Dadurch hätte man an konstruktiven Lösungen arbeiten können.

Während in Deutschland der Nutzer die Dokumente für Leistungserbringer freigeben muss, sind sie in anderen Ländern für definierte Gruppen einsehbar und müssen, wenn dies nicht gewünscht ist, gelöscht oder verschattet werden. Dabei wäre es ein Vorteil, wenn der Austausch zwischen den Leistungserbringern automatisch angelegt und ermöglicht sei, zeigte sich ein Teilnehmer der Runde überzeugt: „Nur so können Vorteile einer ePA zur Erhöhung zur Versorgungsqualität zum Tragen kommen.“

Unterschiedliche Auffassungen gab es darüber, ob Daten gelöscht oder lediglich verschattet werden sollten. „Daten können zu einem späteren Zeitpunkt relevant werden, dann kann die Verschattung aufgehoben werden, wenn man sie doch zeigen will“, erläuterte ein Teilnehmer. Doch ein Teilnehmer verwies darauf, dass es ein Recht auf Löschung gibt: „Die Betroffenenrechte aus der Datenschutzgrundverordnung stehen auch Patienten zu, die kann man nicht einfach aushebeln“, betonte er. Wenn man nur verschatten wolle, müsse man dies gut begründen.

Nutzenerlebnis und Transparenz: Basis für eine erfolgreiche Implementierung
Ärzte: Aufklärung und technischer Support
Was wäre nötig, um eine höhere Anzahl an Nutzern der ePA zu erreichen? Ein Teilnehmer zeigte sich überzeugt, dass der Weg über die Ärzte führe. Denn die Patienten vertrauen ihrem eigenen Arzt am meisten. Deshalb sei dies der primär wichtigste Kontakt, um die Anwendung voranzubringen. Doch seien Ärzte nach wie vor skeptisch und durch die geringe Zahl der Anwendung hätten sie auch keine Routine. Damit drohe die Akte zum Rohrkrepierer zu werden.

In Österreich habe es zu Beginn der Einführung der dortigen „ELGA“ massive Widerstände seitens der Ärzte gegeben. Zum einen wurde die zusätzliche Arbeit und die technische Umsetzung gefürchtet. Zum anderen gab es die Sorge vor Haftungsproblemen. Wären in der Akte nicht alle Dokumente enthalten oder einsehbar, könnte der behandelnde Arzt hier Probleme bekommen, so die Befürchtung. Doch durch Aufklärung, Softwareunterstützung für jeden Arzt und finanzielle Zuwendung für diejenigen, die sich der ELGA anschlossen, konnte die Situation entschärft werden.

Patienten: Akzeptanz gewinnen durch spürbaren Nutzen, Vertrauen durch Transparenz
Ganz entscheidend für Akzeptanz sei die Transparenz, wer auf die Dokumente zugegriffen hat. In Österreich kann jeder Inhaber die Zugriffsprotokolle auf seiner ELGA sehen und nachverfolgen. Dabei ist es wichtig, dass nicht nur die Institution genannt ist, sondern auch der Name der Institution. Damit können viele Fragen geklärt werden. „Oft vermuten die Menschen einen unberechtigten Zugriff, weil jemand aus einem entfernten Krankenhaus auf ihrer ELGA erscheint, wo sie nie waren. Das kann aber zum Beispiel sein, wenn der behandelnde Arzt dorthin eine Blutprobe zur Untersuchung geschickt hat“, erläuterte ein Diskutant. Diese Transparenz habe in Österreich dazu beigetragen, dass das Vertrauen gestärkt wurde. Nach der Einführung der ELGA nutzen etwa 270.000 Menschen die Möglichkeit des Opt-out, während der Pandemie traten viele wieder bei. Mittlerweile haben in Österreich 89% der sozialversicherungspflichtigen Bevölkerung inklusive der Kinder eine ELGA angelegt. In Deutschland sind es vermutlich weit unter 1%.

Für die Patienten wird die ePA dann attraktiv, wenn sie den Nutzen spüren. Da die „ePA 2.0“ mehr Nutzen hätte, war ein Teilnehmer des Gesprächs der Auffassung, dass sich die Akzeptanz erhöhen wird. Er sah aber eine vertane Chance: Die Einführung des eRezepts als größter „Massen-Use-Case“ hätte die Nutzung der ePA sowohl bei Patienten als auch bei Ärzten als zentral steuerndes Element etablieren und damit voranbringen können. Doch das eRezept läuft nicht über die ePA, sondern über eine gesonderte App der Gematik.














