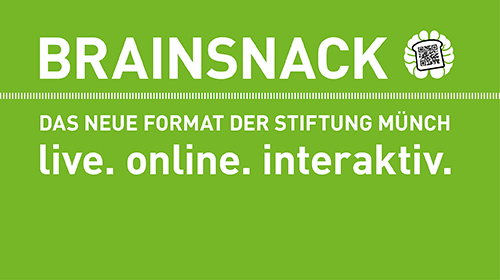9. Juli 2019
116 117 oder 112? Krankenhaus oder Bereitschaftspraxis? Notarzt oder Rettungssanitäter? Wann übernimmt die Krankenkasse die Kosten? Die Notfallversorgung in Deutschland ist kompliziert – sowohl aus der Sicht der Patienten als auch aus Sicht der beteiligten Akteure. Und das sind viele: zum einen die Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen), die die ambulante Versorgung der Patienten auch außerhalb der Praxiszeiten gewährleisten müssen. Zum anderen die Kliniken, die in ihren Ambulanzen die Notfallpatienten versorgen – darunter auch viele, die streng genommen keine Notfallpatienten für das Krankenhaus sind. Dann gibt es noch den Rettungsdienst: Er muss im Notfall vor Ort sein, die Erstversorgung leisten und bei Bedarf den Transport in die Klinik übernehmen. Dabei ist wiederum zu klären, welche Kompetenzen die Notfallsanitäter haben und welche Aufgaben nur von einem Notarzt übernommen werden können. Zusätzlich erschwerend kommt dazu, dass für den Rettungsdienst die Länder zuständig sind, in denen zum Teil wiederum von Kommune zu Kommune unterschiedliche Regelungen gelten.
Ob der Rettungsdienst in seiner bestehenden Form noch zeitgemäß ist und welche Änderungen erforderlich sind, um die Notfallversorgung zu verbessern, darüber diskutierten die Teilnehmer des Luncheon Roundtables der Stiftung Münch im Juni.
Zu den Teilnehmern gehörten:
- Frédéric Bruder, Geschäftsführer, ADAC Luftrettung gGmbH
- Dr. Michael Bayeff-Filloff, Ärztlicher Landesbeauftragter Rettungsdienst, Bayrisches Staatsministerium des Inneren für Sport und Integration (Rettungswesen)
- Dr. Bernhard Flasch, Chefarzt Zentrale Notaufnahme, Klinikum Frankfurt
- Sophie Schwab, Leiterin Landesvertretung Bayern, DAK-Gesundheit
- Thomas Stadler, Abteilungsleiter, BRK Landesgeschäftsstelle
- Dr. Branko Trebar, Leiter der Abteilung Versorgungsstruktur, KBV
- Prof. Claudia Wöhler, Landesgeschäftsführerin, BARMER Landesvertretung Bayern
sowie von der Stiftung Münch Stephan Holzinger (Vorstandsvorsitzender), Eugen Münch (stv. Vorstandsvorsitzender), Professor Bernd Griewing (Vorstand), Professor Boris Augurzky (wiss. Geschäftsführer), Dr. Johannes Gruber (Geschäftsführer) und Annette Kennel.
Der Rettungsdienst hat die Aufgabe, in Notfällen zu jeder Zeit Hilfe zu leisten. Die Notfälle reichen von Katastrophenschutz über Großschadensereignisse bis hin zu medizinischen Fragestellungen im Einzelfall. Er gilt jedoch nicht als medizinische Versorgungsleistung und ist daher nicht im SGB V integriert, sondern Bestandteil der Fahrtkosten oder Versorgung mit Krankentransportleistung. Der Bundesrat hatte beantragt, den Rettungsdienst in das SGB V aufzunehmen, dies wurde jedoch vom Bundestag zuletzt 2014 abgelehnt. Die Kosten für den Rettungsdienst werden deshalb nur von der Krankenkasse übernommen, wenn eine weitere Versorgung des Patienten im Krankenhaus nötig ist. Kritiker beanstanden, dass deshalb viele Patienten in die Kliniken gebracht würden, obwohl dies gar nicht immer nötig wäre. So entstehen unnötige Kosten.
Im aktuellen Koalitionsvertrag ist eine Reform der Rettungsstellen vorgesehen und unter anderem auch die erforderliche Grundgesetzänderung, um den Rettungsdienst in das SGB V zu integrieren. Rettungsdienste sollen dann die von KVen und Kliniken gemeinsam betriebenen Integrierten Notfallzentren als zentrale Anlaufstelle anfahren. Der Rettungsdienst wird zu einem eigenen Leistungsbereich, nicht zuletzt, um unnötige Krankenhauseinweisungen zu vermeiden. Die Neuregelungen sollen 2021 in Kraft treten, die erforderliche Gesetzänderung bis 2020 stattfinden und anschließend der G-BA mit der Umsetzung bis 2021 beauftragt werden.
„Wenn es in der Notfallversorgung nicht gelingt, die Sektoren zu überwinden und zu vernetzen, dann gelingt es nirgendwo“, mahnte ein Diskutant. Den Sicherstellungsauftrag der KVen aufzubrechen, wertete er als Schritt in diese Richtung. Es dürfte nicht nur ums Geld gehen, sondern darum, die Hürden zu überwinden, sonst drohe ein ernsthaftes Problem für die Gesundheitsversorgung der Zukunft.
Ein Teilnehmer der Diskussion begrüßte es, dass der Rettungsdienst als eigener Sektor entwickelt wird. „Ein „weiter so“ kann es nicht geben“, betonte er. Er mahnte an, dass die Vorhaltekosten geplant werden müssten. Denn eine Zentralisierung in der Krankenhauslandschaft oder die Einführung von Notfallzentren hätten sofort Auswirkungen auf den Rettungsdienst und gingen in der Regel mit steigenden Einsatzzahlen einher. „Wenn wir die Krankenhausstrukturen zentralisieren wollen, müssen wir unbedingt den Rettungsdienst mitdenken“, so ein weiterer Teilnehmer. Rettungsdienst und Notfallversorgung müssten als Ganzes gedacht werden, betonte auch ein anderer Diskutant.
Der Run auf die Notaufnahmen der Kliniken – was steckt dahinter?
Viel zu viele Patienten landen in den Ambulanzen der Kliniken oder rufen die Rettungsleitstelle, obwohl sie keine medizinischen Notfälle im eigentlichen Sinne sind. Umfragen zeigen, dass bei Beschwerden insbesondere jüngere Menschen die Notaufnahme aufsuchten, ältere Menschen und auch die Bevölkerung auf dem Land dagegen eher zum Hausarzt gingen. Die Nummer der kassenärztlichen Bereitschaft 116 117 ist zwar mittlerweile gut 50 Prozent der Bevölkerung bekannt, dennoch wird immer noch zu häufig die 112 gewählt.
Würde eine einheitliche Nummer helfen, die von den Patienten angerufen wird und von der aus nach einer Triagierung die weitere Versorgung organisiert wird? In Baden-Württemberg wurden die Nummern zusammengelegt, berichtete ein Teilnehmer. Es habe sich aber gezeigt, dass dadurch die Zahl der Rettungseinsätze nicht verringert wurde. In Bayern wurden die 112 und die 116 117 ebenfalls zusammengelegt – und dies wieder rückgängig gemacht. Durch die zusätzlich am Rettungsdienst involvierten Teilnehmer wie Polizei und Feuerwehr und die mangelnde digitale Vernetzung sei ein zu hoher Aufwand entstanden. Um das zu beheben, bedürfe es hoher Investitionen, die „irgendwann“ getätigt werden müssten.
Ein weiterer Grund, weshalb Patienten lieber gleich eine Notaufnahme aufsuchten, liege auch darin, dass die Bereitschaftspraxen nicht rund um die Uhr geöffnet sind und zudem die Qualifikation der diensthabenden Ärzte nicht immer geeignet ist. „Wenn bei einem Patienten mit Brustschmerzen ein Strahlentherapeut kommt, wird er den Patienten auch in die Klinik schicken, weil er unsicher ist“, so ein Teilnehmer. Es gäbe keine Ausbildung für Bereitschaftsärzte der KV, diese halte er für dringend nötig.
Patientensteuerung, Triagierung und Transport im Rettungswagen braucht digitale Unterstützung
Nötig wäre es, die Patienten ihrem Zustand entsprechend an die richtige Stelle im System zu lotsen. Digitale Diagnosesysteme können diese Steuerung unterstützen. Digitale Unterstützungssysteme zur Triagierung werden auch bei der 116 117 eingeführt. Die KVen setzen dazu SmED ein, das aus der Schweiz übernommen wurde. Damit könne eine erste Einschätzung gelingen. Im Hintergrund werde zudem Künstliche Intelligenz trainiert, die lerne, ob der Anrufer beispielsweise seine Beschwerden über- oder unterschätze und zusätzlich auf Schlagwörter achte, die der betreuende Mitarbeiter am Telefon nicht überhören dürfe, um die richtige Entscheidung zu treffen. „Auch ein Patient mit Schnupfen fühlt sich als absoluter Notfall“, so ein Diskutant, „Diese Fälle müssen wir rausfiltern, das muss aber ein Mensch machen.“
Auch telemedizinische Anbieter wie Medgate könnten sinnvoll eingebunden werden: Anhand von sieben Fragen kann dort bereits jetzt eine Entscheidung getroffen werden, ob eine telemedizinische Behandlung möglich ist oder nicht. Das Ergebnis könnte dann direkt an den Rettungsdienst übergeben werden.
Die Vernetzung zwischen Leitstelle, kassenärztlichem Bereitschaftsdienst, dem Rettungswagen und der Klinikambulanz lässt jedoch zu wünschen übrig. Und auch der Einsatz von Telemedizin und digitalen Lösungen ist nicht ausreichend. In Dänemark werden die Daten des Patienten bei der Ankunft des Rettungsdienstes erhoben, die Behandlung beginnt im Krankenwagen – alle Informationen sind bereits vor dessen Eintreffen in der Klinik einsehbar.
Davon ist Deutschland weit entfernt. „Wir haben eine sehr heterogene Struktur in Deutschland, was die technische Ausstattung anbelangt“, formulierte es ein Diskutant. Das und auch die unterschiedlichen Zuständigkeiten je nach Region führe oft dazu, dass Daten erhoben werden, jedoch nicht zum Beispiel ins benachbarte Krankenhaus übertragen werden können, weil das dortige System nicht kompatibel sei. Zudem verhindere der Datenschutz etwa, die von der KV erfassten Daten dem Rettungsdienst weiterzugeben. „Wir nehmen Daten auf, wenn der Rettungsdienst ankommt, bei der Ankunft im Krankenhaus und dann noch einmal auf der Station. Das kann nicht sein. Wir sind nicht bereit zu vernetzten. Hier ist der Gesetzgeber gefordert“, betonte ein Teilnehmer.
Ist der Rettungsdienst beim Patienten angekommen, transportiert er diesen meist in eine Klinik. Denn nur dann werden die Kosten von der Krankenkasse übernommen. „Es landen also zusätzlich Patienten in der Notaufnahme, die da nicht hingehören“, unterstrich ein Diskutant. Doch oft habe der Rettungsdienst auch keine andere Möglichkeit: selbst, wenn die Behandlung bei einem niedergelassenen Arzt angezeigt wäre, etwa um eine Platzwunde zu versorgen, können sie keine Praxis anfahren.
Ein großes Problem sahen die Teilnehmer der Gesprächsrunde in der mangelnden Transparenz. „Das ist ein Grundproblem: wir haben keine bundesweiten Daten und keine strukturierte bzw. einheitliche Auswertung“, fasst es einer zusammen, „wir haben schlicht eine Blackbox“. Ein Beispiel: einige Patienten, die nach dem Anruf bei der Rettungsstelle nicht schnell genug Hilfe erfahren, rufen erneut an – es werden dann zwei Rettungswagen geschickt, weil nicht erkennbar ist, dass bereits ein Wagen auf dem Weg ist.
Notfallsanitäter als neuer Beruf mit erweiterten Kompetenzen
Eine weitere Baustelle besteht bei den Kompetenzen. Nach einer Gesetzesänderung („Notfallsanitätergesetz“), die zum Januar 2014 in Kraft trat, wird der Rettungsassistent abgelöst durch einen hauptamtlichen Notfallsanitäter, der ab 2024 in jedem Rettungswagen sein muss. Er benötigt eine dreijährige Ausbildung und hat erweiterte Kompetenzen, wozu auch Aufgaben gehören, die bisher Ärzten vorbehalten waren, wie zum Beispiel das Legen von Infusionen. Damit können die Notärzte entlastet und den Patienten schneller geholfen werden. Denn der Notarzt ist zwar Teil des Rettungsdienstes, muss aber bei Bedarf eigens angefordert werden. Dennoch sei eine klare, einheitlich geregelte Trennung und Zuteilung der Aufgaben erforderlich. Einige Teilnehmer der Diskussion fanden diese Neuerung sinnvoll, da gerade auf dem Land durch den bestehenden Ärztemangel so die Versorgung besser gewährleistet werden könne. In Bayern, wo der Notfallsanitäter bereits im Einsatz sei, zeige sich, dass die Qualität der Versorgung nicht zu beanstanden ist, und der Notfallsanitäter entwickle sich zu einem attraktiven Beruf. Dies ist wichtig, da sich zunehmend weniger Ärzte als Notarzt engagieren wollen. Dies liege zum einen daran, dass es in einigen Gebieten schwierig sei, überhaupt noch Ärzte zu gewinnen. Zum anderen sei die Bezahlung nicht attraktiv: „Ein Notarzteinsatz wird mit 98 Euro vergütet, ein niedergelassener Arzt im Bereitschaftsdienst erhält etwa die dreifache Summe“, so ein Teilnehmer.
Bemängelt wurde auch, dass die verschiedenen Anbieter im Rettungsdienst miteinander konkurrieren, was unter anderem dazu führe, dass mehrere Rettungswagen unterschiedlicher Träger zu einem Notfall fahren. Außerdem würde dadurch eine große Spannbreite bei der Vergütung eines Rettungsdiensteinsatzes existieren. Diese reiche von 290 Euro bis 950 Euro, wie der Bundesrechnungshof ermittelt habe. „Da kann nicht richtig gerechnet worden sein“, so ein Teilnehmer.
Der Patient als Konsument mit steigenden Ansprüchen
Alle vorgeschlagenen Änderungen und Anpassungen kommentierte ein Teilnehmer der Runde: „Wir schauen, dass wir das Gesundheitssystem im bewährten Schneckentempo weiterentwickeln und jeder seine Besitzstände wahrt. Dabei ist doch die Frage: Wie stellen wir uns die Gesundheitsversorgung der Zukunft vor?“ Da müsste der Patient in den Fokus. Dem sei es egal, ob es Sektorengrenzen gibt und wie die Vergütung geregelt ist. Er möchte schlicht die Lösung seines Problems. Patienten haben inzwischen außerdem ein „Convenience“-Denken entwickelt und erwarten Service, wie sie es etwa bei der Nutzung von Amazon gewöhnt sind: „Man kann viel diskutieren, ob das richtig oder falsch ist, aber es ist schlicht ein Fakt, mit dem wir umgehen müssen.“
Die Zusammenfassungen der anderen Luncheon Roundtable-Gespräche finden Sie HIER